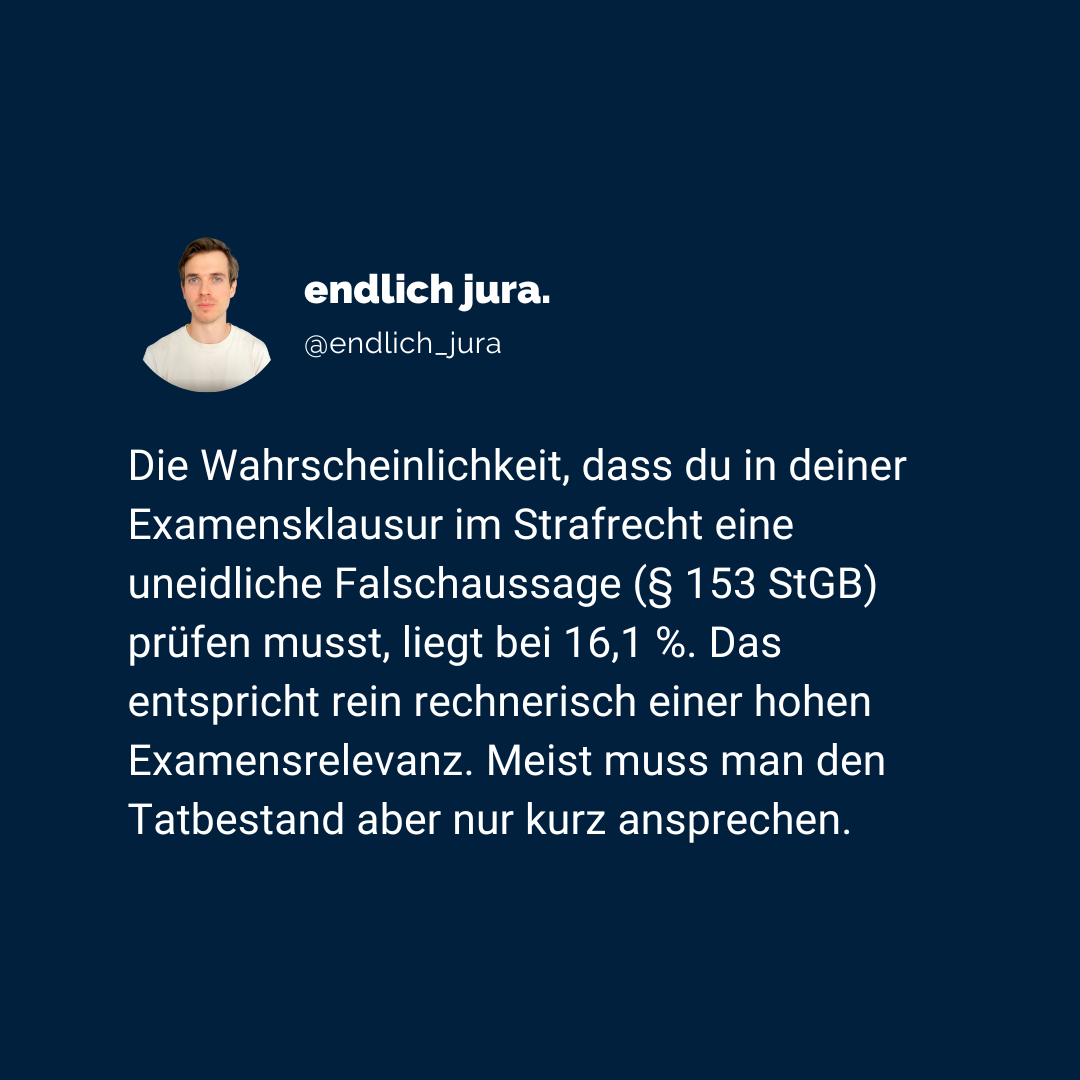JNG #314: Aussagedelikte im Überblick: In 4 Minuten zum Examenswissen

Diese Ausgabe wird präsentiert von endlich jura. All-Access – der Nr. 1 Lösung für dein Jura-Studium.
Warum lohnt es sich, Mitglied bei uns zu werden?
✔ Zugriff auf 60+ Original-Examensklausuren mit Lösung
✔ Jeden Monat zwei neue interaktive Fallbesprechungen
✔ Möglichkeit, deine Fragen direkt in der wöchentlichen Sprechstunde zu klären
Mach es dir nicht so schwer! Teste All-Access jetzt kostenlos – vielleicht können wir ja auch dich unterstützen!
Lesezeit: 4:03 Minuten
In dieser Ausgabe von Jura neu gedacht werfen wir einen stark komprimierten Blick auf die examensrelevanten Aspekte des neunten Abschnitts des Strafgesetzbuchs – also auf die Aussagedelikte. Ziel ist es, das notwendige Wissen so knapp und verständlich wie möglich zu vermitteln. Grundlage der Auswahl sind 329 Examensklausuren der letzten 20 Jahre, aus denen sich typische Schwerpunkte und Prüfungsgewohnheiten klar erkennen lassen.
Was kann gestrichen werden?
Beginnen wir mit den Normen, die nach Auswertung der Examensfälle keine praktische Relevanz besitzen. Diese können – bei knapper Vorbereitungszeit – guten Gewissens ausgeklammert werden. Wer ein StGB in Papierform nutzt, darf sie gern durchstreichen:
- § 154 StGB (Meineid)
- § 155 StGB (Gleichstellung mit dem Eid)
- § 156 StGB (Falsche Versicherung an Eides statt)
- §§ 161–163d StGB (u. a. Aussageerpressung, Verletzung von Privilegien etc.)
Diese Vorschriften waren in den ausgewerteten Klausuren nicht relevant oder führten im besten Fall zu Prüfungen ohne Punktrelevanz.
§ 153 StGB – Falsche uneidliche Aussage
Diese Norm ist in Examensklausuren die zentrale Vorschrift. Drei Punkte sind hier besonders wichtig:
- Eigenhändiges Delikt
Die falsche uneidliche Aussage kann nur vom Täter selbst begangen werden – also vom Zeugen oder Sachverständigen, der tatsächlich aussagt. Eine mittelbare Täterschaft ist grundsätzlich ausgeschlossen. Dies ist vergleichbar mit Delikten im Straßenverkehr, bei denen z. B. das Führen eines Fahrzeugs ebenfalls nur persönlich möglich ist. - Zuständige Stelle
Die falsche Aussage muss »vor Gericht oder vor einer anderen zur eidlichen Vernehmung von Zeugen oder Sachverständigen zuständigen Stelle« erfolgen. Ob auch Aussagen gegenüber der Polizei darunterfallen, wird oft geprüft. Die Antwort ist: Nein. Nach deutschem Recht ist die Polizei grundsätzlich keine solche Stelle im engeren Sinne des Strafverfahrens – es sei denn, sie handelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft oder unter deren Leitung (vgl. §§ 161a, 163 StPO). Einfache Aussagen gegenüber der Polizei fallen daher nicht unter § 153 StGB. - Tatbestandsmerkmal »falsch«
Zur Auslegung des Merkmals »falsch« existieren drei Theorien: - Objektive Theorie: Aussage entspricht objektiv nicht der Wirklichkeit.
- Subjektive Theorie: Aussage weicht vom tatsächlichen Vorstellungsbild des Aussagenden ab.
- Pflichttheorie: Aussage ist pflichtwidrig, wenn der Zeuge erkennbar nicht sorgfältig über das Erinnerte reflektiert hat.
In der Klausur genügt es, Extrempositionen zu bilden, wenn man diese drei Ansätze nicht kennt, und zu verstehen, wie man zwischen ihnen differenzieren kann. Eine saubere Gegenüberstellung genügt.
§ 157 StGB – Strafmilderung bei Aussage zur Selbst- oder Angehörigenrettung
- 157 StGB erlaubt Strafmilderung oder -verzicht, wenn der Zeuge oder Sachverständige durch die Falschaussage die Gefahr einer Bestrafung oder freiheitsentziehenden Maßnahme gegen sich oder Angehörige abwenden wollte. Wichtig ist:
- Zunächst sind die §§ 34, 35 StGB (rechtfertigender und entschuldigender Notstand) vorrangig zu prüfen.
- Die Formulierung »um … abzuwenden« signalisiert eine überschießende Innentendenz: Es genügt, wenn der Täter glaubt, dass er durch die Aussage sich oder einen Angehörigen schützen könne – unabhängig davon, ob die Gefahr tatsächlich bestand.
§ 158 StGB – Berichtigung einer falschen Aussage
158 StGB ist ein persönlicher Strafaufhebungsgrund – vergleichbar mit dem Rücktritt nach § 24 StGB. Er gilt nur, wenn die Vernehmung bereits abgeschlossen ist. Eine Berichtigung während laufender Vernehmung ist keine »Berichtigung« im Sinne des § 158.
Zu beachten ist der Begriff »verspätet« in Abs. 2: Eine Berichtigung ist zu spät, wenn durch die Aussage bereits ein Nachteil entstanden ist – etwa durch eine vorläufige Festnahme.
Hinweis: Manchmal stellt sich die Frage, ob § 158 analog auf § 164 oder § 145d StGB anwendbar ist. Das ist Spezialwissen – es reicht, das Problem zu erkennen und einige sinnvolle Gedanken dazu zu formulieren.
§ 159 StGB – Versuch der Anstiftung zur Falschaussage
Wird geprüft, weil § 30 StGB keine versuchte Anstiftung zu Nicht-Verbrechen umfasst. Die Falschaussage ist aber kein Verbrechen. Deshalb regelt § 159 StGB explizit die Versuchsstrafbarkeit – mehr musst du nicht wissen.
§ 160 StGB – Verleiten zur Falschaussage
Der wohl schwierigste Tatbestand unter den Aussagedelikten! Laut Abs. 1 ist das »Verleiten« zur falschen uneidlichen Aussage strafbar. Problematisch ist dabei:
- Was bedeutet »verleiten«?
- Wie ist der Fall zu behandeln, wenn der Aussagende (meist ein Zeuge) die Manipulation durchschaut und bewusst falsch aussagt?
Hierzu gibt es zwei Ansätze:
- Schutzgutbezogener Ansatz (Rspr.)
Das Delikt schützt die objektive Funktionsfähigkeit der Rechtspflege. Ob der Zeuge sich täuschen lässt oder nicht, ist irrelevant – strafbar ist, wer die Rechtspflege gefährdet, indem er zu einer Falschaussage verleitet. - Mittelbare Täterschaft (h. L.)
§ 160 Abs. 1 wird als gesetzlich geregelte Form der mittelbaren Täterschaft verstanden. Voraussetzung ist dann ein »Defekt« beim Vordermann – also Gutgläubigkeit. Ist der Zeuge bösgläubig, liegt keine mittelbare Täterschaft vor.
In der Klausur reicht es, das Problem zu benennen und verschiedene Interpretationen gegenüberzustellen.
Fazit
Das war der gesamte Abschnitt zu den Aussagedelikten – konzentriert auf das Wesentliche. Wer diese Punkte sicher beherrscht, ist im Examen bestens vorbereitet. Weitere Vertiefung ist natürlich immer möglich, aber nicht wirklich erforderlich. Wer sich in der Prüfung auf das konzentriert, was geprüft wird – und nicht auf das, was möglich wäre – hat mehr Zeit für das, was Punkte bringt.
Neues YouTube-Video
Du brauchst eine schnelle, verständliche Einführung in die Anfechtung nach BGB? In diesem Video erkläre ich dir die wichtigsten Anfechtungsgründe (Irrtum, arglistige Täuschung, Drohung), Fristen der Anfechtung, Rechtsfolgen nach § 142 BGB und typische Fehlerquellen im Gutachtenstil – kompakt in 10 Minuten (oder weniger). 
#examensrelevant